In die „Heimat“ zurückgekehrt
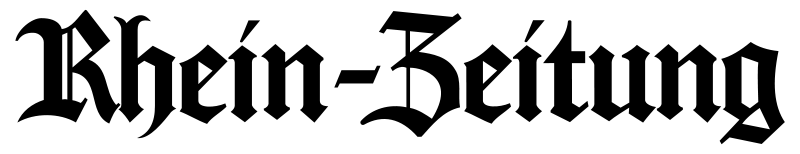
Ein Sportflugzeug zerschellt am Loreleyfelsen, die Explosion ist gewaltig. Die Dreharbeiten der dritten „Heimat“-Staffel erleben im Rheintal dramatische Szenen. Edgar Reitz ist hochkonzentriert bei der Arbeit. Er hat den Hunsrück mit seinem Werk bekannter gemacht als je einer vor ihm. Dabei wollte er niemals zurückkehren, als er seine Heimat mit 15 verließ. Lesen Sie mehr im JOURNAL
Edgar Reitz vollendet sein Werk. Bis Oktober dreht er die dritte Staffel seiner „Heimat“. Sie beginnt am 9. November 1989, dem Tag des Mauerfalls. In Berlin treffen sich zufällig Hermann Simon und Clarissa Lichtblau wieder und kehren in den Hunsrück zurück, um hier gemeinsam alt zu werden.
– Lesen Sie ein Gespräch mit Regisseur Edgar Reitz (70) und eine Reportage über die Filmaufnahmen im Rheintal.
Als Edgar Reitz im Alter von 15 Jahren seine Heimat Hunsrück verließ, sollte es für immer sein. Er kam nach Jahrzehnten als Filmemacher zurück. Der Hunsrück und seine Menschen wurden zum Mittelpunkt seiner Trilogie „Heimat“. GERD DANCO, der Vorsitzende des Hunsrückvereins und ehemalige Regierungspräsident, unterhielt sich mit dem Regisseur.
Herr Reitz, Sie sind Ehrenbürger der Stadt Simmern, der Stadt, in der Sie beinahe zehn Jahre als Schüler gelebt und Abitur gemacht haben. Durch Ihr Filmschaffen, die „Reise nach Wien“, insbesondere aber durch das Filmepos „Heimat“, sind Sie wohl unbestritten der weltweit bekannteste Hunsrücker geworden. Wie empfinden Sie heute den Hunsrück, ist er im Vergleich unterschiedlich zu dem, den Sie vor 50 Jahren verlassen haben?
Es gibt da eine perspektivische Umkehrung, die ich natürlich zu Beginn der Geschichte überhaupt nicht ahnen konnte. Zunächst einmal war es so, dass für mich als Hunsrücker Kind die Zukunft hinter dem Horizont lag. Alles was ich mir als Zukunft vorstellte, war nicht dort zu suchen, wo ich mich befand, nicht im familiären Umfeld, auch nicht unter den damals nahestehenden Freunden aus der Schulzeit. Wir alle richteten unsere Blicke hinter die Horizonte des Hunsrücks. Warum? Ich bin das Kind eines Handwerkers, eines Uhrmachers aus Morbach, der wiederum das Kind eines Dorfschmieds ist aus dem Nachbarort Hundheim, der gleichzeitig seine Landwirtschaft hatte, wie das in den Dörfern üblich war. Meine Mutter ihrerseits war die Tochter eines bescheidenen kleinen Bahnbeamten, aus kinderreicher Familie mit sehr geringem Einkommen des Vaters. Alle Verwandten, die wir hatten, stammten aus bäuerlichem Milieu, lebten fest an Hunsrücker Traditionen gebunden. Für mich war da nicht viel Zukunft zu sehen. Alles was ich da vor mir sah, sprach von Vergangenem, teilweise von bereits Überlebtem; das Festhalten an den Ort, an den Berufen und regionalen Erwerbstätigkeiten bedeutete für mich, sich an Vergangenes zu klammern. So war es in den Nachkriegsjahren, in denen ich anfing, mein Weltbild zu formen. Ich war zwölf Jahre alt, als der Krieg zu Ende ging. Das ist ein Alter, in dem man gerade anfängt, über die Horizonte hinaus zu denken. In dieser Zeit war nicht nur die Nazizeit, sondern auch ein überliefertes Weltbild zu Ende gegangen. Man sah deutlich, dass alle Dinge, die aus der Tradition heraus kamen, keine Katastrophen hatten verhindern können und kaum Lösungen für unsere Zukunft versprachen. Auch der Beruf des Vaters als Uhrmacher in Morbach hatte nach dem Krieg letztendlich keine Zukunft mehr. In den fünfziger Jahren haben sich die Kaufgewohnheiten komplett verändert: man kaufte nicht mehr seine Uhr im Fachgeschäft, sondern in den Versandhäusern. Die Konsumgewohnheiten orientierten sich an der überregionalen Reklame, wie sie durch Rundfunk und Fernsehen kam und durch die Presse, durch die Medien also, die in dieser Zeit erst zu dem heranwuchsen, was sie heute sind. Der Blick vieler Hunsrücker richtete sich jetzt nach außen und wer immer sich am Herkömmlichen festhielt, klammerte sich, gesehen aus meiner Sicht als Schüler, an den Untergang. Und so sah es auch der eine oder andere Mitschüler. Nur sie wählte man sich zu Freunden, weil man mit ihnen Zukunftspläne schmieden konnte. Und da Zukunft jenseits der Horizonte lag, war das Weggehen programmiert. Weggehen heißt, alles zurücklassen, was man nicht mitnehmen kann. Was kann man mitnehmen, wenn man das Kind eines Bauern ist? Das Haus kann man nicht mitnehmen, das Ansehen, das man genießt im Dorf, kann man nicht mitnehmen, die Würde, die man durch das Wirken der Eltern und Vorfahren hat, kann man nicht mitnehmen. Man kann ja nicht einmal Hab und Gut mitnehmen, denn es war ja kaum etwas vorhanden, das man in Bargeld verwandeln konnte. Das einzige, was ein junger Mensch aus dem Hunsrück mitnehmen konnte, das ist seine Intelligenz, das was er im Kopf hat, das Selbstbewusstsein und die Fähigkeit, zu lernen und zu denken. Das habe ich damals so gesehen, denn der Hunsrück mit seinen Traditionen und Angeboten, seinen Zukunftsperspektiven spielte in meiner Lebensplanung schon im Alter von 15 Jahren keine Rolle mehr. Was ich jahrelang vor mir sah, war aber eine gerade Strecke, und sie führte weg von hier, um nie mehr zurückzukehren! Das war mein Antrieb! Wenn ich heute sehe, wie sich die Dinge entwickelt haben, wie sich die Perspektive umgekehrt hat – dass ich eines Tages die Heimat als Quelle von Geschichten und Energie für mein künstlerisches Schaffen entdeckte – dann ist das etwas, womit ich niemals gerechnet hätte. Wer hätte denn gedacht, dass ausgerechnet in der engen Heimat etwas verborgen lag, das ich immer vergeblich gesucht hatte: ein Schatz von Poesie und Schönheiten! Heute weiß ich: Die Dinge haben ihren Wert in der Ferne erst neu bekommen müssen.
Sie wollten loskommen vom Idiom der Heimat, also vom Dialekt, so dass Sie sich sogar entsprechend geschult haben. Wenn Sie heute nach Morbach kommen, sprechen Sie platt oder sprechen Sie das Deutsch, das Sie beruflich oder das Sie sonst außerhalb des Hunsrücks sprechen und sprechen müssen?
Ich glaube, mein Verhältnis zum Platt wurde durch meinen Werdegang und die vielen Jahre, die ich in Großstädten lebte, ruiniert. Es fehlte ganz einfach auch die Praxis. Wenn ich im Hunsrück bin, also nach zwei Gläsern Wein, fange ich manchmal an, platt zu sprechen und nach dem dritten Glas kann ich nicht mehr richtig Hochdeutsch. Da öffnen sich sozusagen die verschütteten Quellen, und beide Sprachen vermischen sich. Über dem Platt liegt natürlich der gesamte Bildungsweg, es litt unter der Erziehung, auch den Vorsätzen, mit denen man einmal aufgebrochen ist. Das Abitur, das Studium ließen einen in eine allgemeinere internationale Sprache hineinwachsen. Da hat man sich schließlich etwas erworben, das man als Dialekt sprechender Mensch wieder hätte verlieren können. Nur, wenn ich Filme mache, ist es anders: Ich war so lange auf dem falschen Wege, wie ich das Filmemachen als intellektuellen Akt begriff. Mit dem Film „Heimat“ habe ich im Grunde das Abitur zurückgegeben. Wohin führen uns die Bildungssysteme? Wohin führen die Schulen? Sie führen uns nicht unbedingt zu uns selbst. Sie führen uns in ein allgemeines Verständnis einer Gemeinschaft, einer Gemeinschaft der Gebildeten und einer Gemeinschaft der Wissenden. Die Humboldt’sche Bildungswelt, wie wir sie in der deutschen Hochkultur verwirklicht sehen, enthält das Versprechen der Geborgenheit in einer Gemeinschaft der Gebildeten. Aber diese Geborgenheit genießen die Gebildeten besonders selten. Ich fühlte mich auf meinem klassischen Bildungsweg immer einsamer, je weiter ich voranschritt. Für Bildung wird man anerkannt, beneidet, vielleicht bewundert, aber nicht geliebt. Man kann sich profilieren, man kann sich vor den anderen hervortun, man kann mit Formulierungen brillieren, aber Liebe erwirbt man sich nicht damit. Ich meine, da stimmt etwas nicht. Vielleicht gingen die Rechnungen einmal in den großbürgerlichen Zeiten des 19. Jahrhunderts auf, vielleicht sogar im Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Gebildeten noch an der gesellschaftlichen Macht teil hatten. Heute haben sie es nicht mehr und man weiß nicht, was man für Bildung, die nicht berufsorientiert ist, noch bekommt. Ich selbst habe nach dem Studium gemeint, meine Sprache verloren zu haben. Ich wäre mit dem ruinierten Verhältnis zur Muttersprache, dem Hunsrücker Platt, nicht mehr in der Lage gewesen, zum Beispiel Schriftsteller zu werden. Im Hochdeutschen waren für mich die Quellen versiegt. Da gab es unerreichbare Vorbilder, von Goethe bis Rilke, aber ein Weg zu mir selbst fehlte. Die elementare Sprache, die Mundart, ist näher am Ich.
Ich will nicht glauben, dass Sie beim Auszug aus der Heimat nichts weiter mitgenommen haben als Ihre Denkfähigkeit, die Fähigkeit, intellektuell zu arbeiten. Ist es nicht doch die Landschaft, die Geschichte, sind es nicht doch die Menschen, die Sie, unbemerkt vielleicht, mitgenommen haben, die Sie nicht abstreifen konnten und die wir heute sehen und erleben können?
Vielleicht habe ich einiges überspitzt ausgedrückt. In erster Linie bin ich Filmemacher, aber ich sehe mich nicht nur als Erfinder von Bildern und als Erzähler von Hunsrücker Geschichten, sondern ich bemühe mich auch um die intellektuellen Fähigkeiten, die mich lehren, mein Tun kritisch zu betrachten und meine Arbeit mit anderen Werken in der Welt der Kunst und des Films zu vergleichen. Diese Vergleichsmöglichkeit besäße ich nicht ohne die Bildungssysteme und ich wäre ohne sie auch nie aus dem Hunsrück weggekommen. Sie gaben mir als erste das Rüstzeug für meinen beruflichen Weg. Wenn ich mich aber heute frage, woher die Schaffenskraft kommt, woher die künstlerische Phantasie kommt, dann muss ich sagen, sie kommt nicht aus dem Bildungssystem, sondern sie kommt aus der Kindheit und sie kommt aus den Bildern und den Tönen und Geräuschen und den Stimmen und den Worten, die man aufgeschnappt hat, die man damals vielleicht noch nicht begriffen hat.

Das Talent und die Schaffenskraft kommen aus einer Art „Ursuppe“, aus der wir alle stammen. Ich sagte vorhin, ich hätte nie Schriftsteller werden können, weil ich meine Themen auf hochdeutsch hätte bearbeiten müssen. Als Filmemacher konnte ich mit Bildern arbeiten, die den Unterschied zwischen „Ursuppe“ und Bildung nicht kennen. Die Bilder, mit denen ich einen Film gestalte, haben keine Vorprägung, sind ursprünglicher als die Sprache, sind nicht an gesellschaftlichem Status, an Wissen und Geschmack zu messen. Ich habe oft gedacht: meine Bilder sprechen immer noch Hunsrücker Platt.
Was nun, Herr Reitz, Sie haben den Hunsrück bekannter gemacht als je einer vor Ihnen in der Geschichte dieser Landschaft, dieses Landes überhaupt. Ich frage Sie für den Hunsrückverein, für den Hunsrücker Geschichtsverein, für viele andere, die sich um den Hunsrück bemühen, denen er Heimat ist, die sie erhalten, schützen, fördern wollen, indem sie mitarbeiten, was würden Sie uns mit auf den Weg geben?
Oh, schwierige Frage. Ich glaube, dass man heute sehr darauf achten muss, dass man all das, was man tut, vergleicht mit dem, was woanders getan wird. Eine Aktivität, wie die des Hunsrückvereins, ist umso wertvoller, je weniger provinziell sie ist. Provinziell heißt, dass man sich für den Nabel der Welt hält oder dass man denkt, man wäre mit seinen Problemen einmalig. Es gibt zwar das Einmalige, denn Heimat ist im tiefsten Sinne immer unverwechselbar, auch jeder Mensch und jede Landschaft sind einmalig, aber es ist heute sehr schwierig geworden, den Kern der Einmaligkeit zu erkennen. Heimat ist etwas Individuelles geworden. Als kollektive Erfahrung ist sie im Schwinden. Wir sprechen vom totalen Individualismus und verwechseln die Vielfalt der Angebote und die Auswahl, die wir beim Kaufen treffen, mit unserer Verwirklichung als Menschen. Zur wahren Heimatpflege gehört das kritische Bewusstsein gegenüber dem kommerziellen Individualismus. Heimat wird einem nicht mehr durch Geburt geschenkt und sie gehört auch nicht mehr nur den Einheimischen. Man erwirbt sie mit viel Wissen und auch im ständigen Kontakt mit den Anderen – persönlich.
Da schließt sich der Kreis: das Provinzielle beschränkt sich ja nicht auf die ehemals sogenannte (ländliche) Provinz, Sie haben heute und gelegentlich an anderer Stelle gesagt, Provinz findet auch anderswo, zum Beispiel auch in dem „leuchtenden“ München statt.
Sie findet heute in den Köpfen statt, und die Köpfe können überall sein. Bei allen Organisationen, sei es im Verwaltungsbereich, im staatlichen Bereich oder auch im Vereinsleben begeht man leicht den Fehler zu denken, die Dinge bewegen sich, weil wir etwas tun. Ein wenig tun sie das, aber im Großen bewegen sie sich weltweit aus dem Zeitgeist heraus. Die Aufmerksamkeit, die Bereitschaft, das was draußen geschieht, wahrzunehmen, es aufzugreifen, oder ihm Widerstand entgegenzusetzen, das ist das Wichtige. Es ist einst das Problem des deutschen Philistertums gewesen, dass man sich selbst für wichtiger hielt, als die Welt draußen, dass man sich gegenüber der bösen Welt abschottet, dass man um seinen Status, den man gesellschaftlich errungen hat, einen Zaun errichtet. In den „guten alten Familien“ musste die Wirklichkeit erst anklopfen, bevor sie eingelassen wurde. Das darf nicht wieder geschehen, selbst wenn die Zeiten härter und gefährlicher werden.
Die Produktion der dritten „Heimat“- Staffel erlebt im Rheintal dramatische Szenen. Am Loreleyfelsen zerschellt ein Sportflugzeug und reißt den Piloten Ernst Simon in den Tod. Nur wenige Tage später steht ein Junge auf dem sagenumwobenen Felsen. Wo sein einziger Freund gestorben ist, will auch Matco aus dem Leben scheiden. Der 15-Jährige stürzt sich in die Tiefe. GABI NOVAK-OSTER durfte Regisseur Edgar Reitz und sein Team einen Tag lang beobachten und erfuhr hinter den Kulissen: Vor allem Aufnahmeleiter Herbert Ruf hatte für die spektakulären Szenen ein hartes Stück (Vor-)Arbeit zu leisten. Auf dem Tisch liegt eine Hochglanz-Ansichtskarte, wie sie Touristen aus dem Mittelrheintal in alle Welt schicken: Grüße von der Loreley. Ein wenig respektlos hat Herbert Ruf in die romantische Felsenlandschaft beiderseits des Ufers Pfeile und Kreuze gekritzelt: die Schauplätze der Szenen und die Positionen der Filmkameras. Lange war im verschlungenen Tal nach optimalen Plätzen gesucht worden – für Thema und Technik gleichermaßen. Ein Mann wie Edgar Reitz überlässt nichts dem Zufall, und das wissen seine Leute genau. Knapp drei Monate vor Ende der Dreharbeiten muss Aufnahmeleiter Herbert Ruf deshalb alle Register seines Könnens ziehen – und auch die seiner Erfahrung. Wochenlang hat er sich mit den beiden nicht alltäglichen Szenen an der Loreley befasst, (noch) mehr als bei anderen Szenen war Organisation im Vorfeld gefragt. „Ein ganzes Geflecht von Kompetenzen“ gab es zu entzerren. Das Drehbuch verlangt Kniffliges: Abseilen in den Hang, pyrotechnische Effekte für eine imposante Explosion mitten im Felsen, Sperrung der vielbefahrenen Bundesstraße mit Umleitung durch hessisches Gebiet, Hubschraubereinsatz und Mobilisieren ehrenamtlicher Rettungskräfte – all das erforderte die Einbindung von Behörden und Ämtern. „Zum Glück sind wir auf viel Wohlwollen gestoßen.“ Loreley und „Heimat“ – zwei Werbeträger, die Millionen mögen. Ein Aufnahmeleiter bei Film und Fernsehen ist in erster Linie für den reibungslosen und planmäßigen Ablauf einer Produktion verantwortlich, so zeichnet das Arbeitsamt das Berufsbild. „Heimat“-Aufnahmeleiter Herbert Ruf kennt die Praxis aus dem Effeff. Die Pflichtaufgaben und die Freiräume, den lästigen und doch so wichtigen Papierkram. Die Chance zu Kreativität und die Pflicht für Flexibilität. Alle 24 Stunden schreibt er eine neue Tages-Dispo, koordiniert und organisiert. Wer muss wann wohin gebracht werden? Wo gibt es Räumlichkeiten zum Umziehen? Wann ist eine Sperrung erforderlich? Wieviel Verpflegung wird für den Drehtag benötigt? Jedes Detail ist geregelt – „bis hin zum Klo“. Der Regisseur – in diesem Falle Edgar Reitz – muss dem Aufnahmeleiter blind vertrauen können. Jeder Fehler kostet Zeit und Geld. Und bringt Verärgerung. Doch bisher ist alles glatt gelaufen. „Edgar Reitz hat mich immer mit Handschlag und einem Lächeln begrüßt“, scherzt Herbert Ruf. Soll zwischen den Zeilen heißen: Der Chef scheint zufrieden.
Explosion gelungen, Aufnahmeleiter Herbert Ruf ist zufrieden. Die intensive Vorarbeit hat sich gelohnt.
Da kommt die Herausforderung an der Loreley gerade recht. Die Cessna von Ernst Simon soll am Felsen zerschellen. Was der spätere „Heimat“-Betrachter nicht sehen darf: Das Flugzeug fliegt natürlich um den Felsen herum, der Berufs-Pilot wurde aus Frankfurt geordert – und bringt den Flieger später wohlbehalten dorthin zurück. Zu einer echten Explosion im Hang muss es dennoch kommen, also muss der (Film-)Mann für Spezialeffekte ran: Jens Döldissen. Etwa 80 Meter über dem Rhein hat er sein „Feuerwerk“ deponiert, gut versteckt. Gegen Abend erhoffen sich die Filmleute ideale Lichtverhältnisse zum Dreh. Die Ernüchterung kommt mit dem Blick gen Himmel: Es beginnt zu regnen. Das Wetter kann eben nicht geplant werden. „Das Kartenhaus fällt jeden Tag mehrfach zusammen“, nimmt Herbert Ruf den Regen gelassen hin. „Wir sind froh drum“, sagt Klaus Altenhofen. Als Wehrleiter der Verbandsgemeinde kennt er die Tücken des trockenen Sommers: Schnell stünde der gesamte Berg in Flammen. Die Feuerwehr ist vorsichtshalber präsent – man weiß nie. Während neugierige Japaner auf dem Loreley-Ausguck ihre Regenschirme aufspannen und es trotzdem noch fertig bringen, ihre Mini-Kameras zu halten, bereitet sich die Höhenrettung der Feuerwehr Bad Salzig auf den steilen Abstieg zum Feuerwerker vor. Jetzt kann gezeigt werden, was nicht nur für den „Ernst“-Fall geübt wurde. „Super-Leute“, lobt Herbert Ruf am Fuße des Felsens. Der Aufnahmeleiter ist angespannter als sonst und steht zu seinen Emotionen: „Klar, das ist doch was anderes als eine beliebig wiederholbare Zimmer-Aufnahme. Diese Szene ist unwiederbringbar.“ Es gibt nur Material für eine Explosion. Das mag der Regen nicht vermasseln, also verzieht er sich und schickt die Sonne raus. Regisseur und Kamerateam haben sich auf der gegenüberliegenden Rheinseite pos- tiert, Funkgeräte überbrücken die Distanz. Es kann losgehen. Nach ein paar Probeflügen wird es ernst. Kamera läuft, „Ernst“ fliegt. Auf die Sekunde kommt das Kommando zur Zündung, ein Feuerball zischt in den abendlichen Himmel. Ein gelungener Dreh. Die kleinen Feuer im Hang interessieren nicht mehr – zumindest nicht die Mannschaft von Edgar Reitz. Jetzt muss doch noch die Feuerwehr ran: Der schnelle Löscheinsatz ist filmreif, wird aber von keiner Kamera eingefangen. Bei Herbert Ruf ist die Anspannung inzwischen gewichen, seine Gedanken sind bereits beim nächsten Tag. Das Entsetzen über den Absturz von Ernst soll gut zehn Stunden später gefilmt werden. Und wieder beginnt der Tag bereits frühmorgens mit Vorbereitungen. Während die Cessna des Vortages wieder in Frankfurt steht, müssen verkokelte Teile eines ausrangierten Fliegers im steilen Loreleyfelsen verteilt werden. Hier ein Rad, dort eine Tragfläche. Natürlich sind da erneut die Männer der Höhenrettung gefragt. Was sie vermutlich nicht ahnen: Noch Stunden später werden sie neben den Teilen sitzen. Warten gehört dazu, vor allem für die Komparsen. Für die echten und falschen Polizisten, für die Rettungskräfte von THW, Rotem Kreuz und Feuerwehr. Und für alle, die auf der gesperrten Straße einen Stau simulieren. Selbst das ist bestens vorbereitet. Neue Autos haben keine Chance, der Stau steht im Jahr 1997. Willkommen sind dagegen Touristen, sogar mit Caravan. Aus Burgen an der Mosel sind zum Beispiel Uschi und Gerd Vogt gekommen. Nachdem sie sich vor eineinhalb Jahren um eine Statisten- Rolle beworben hatten, war die „Heimat“ eigentlich schon abgehakt. Bis plötzlich der Anruf von Helma Hammen kam. Jetzt sind die beiden Moselaner Feuer und Flamme. Im Loreleyfelsen lodern wieder kleine Feuer auf. Wehe, wenn die Wehrleute eingreifen! An dieser brenzligen Stelle bringt Edgar Reitz Hermann Simon ins Spiel, den Bruder des abgestürzten Ernst. Henry Arnold hat Hermann aus dem Hunsrück bereits in der zweiten Folge gespielt. Ein wenig grauer ist der Dirigent seither geworden. Natürlich ist es reizvoll, die Hauptrolle in einer weiteren Staffel zu verkörpern, erzählt er später. Und doch ist es für Arnold „wie ein Neuanfang“. In Berlin ist der 42-Jährige zu Hause, während der Dreharbeiten wohnt er in Oberwesel. Auch im Film ist er mit seiner geliebten Clarissa (Salome Kammer) nicht in die Heimat Hunsrück zurückgekehrt, sondern hat über dem Rhein ein altes Fachwerkhaus umgebaut. Von dort beobachten die Beiden, wie Ernst mit seiner Cessna übers Tal fliegt – und an der Loreley zerschellt. Hermann rast sofort zur Unglücksstelle. Nicht (nur) wegen der fehlenden Brücke dauert es ein wenig länger, bis er auf der gegenüberliegenden Rheinseite ankommt. Die Szene muss öfter gedreht werden als jede andere. Und ein ums andere Mal versucht der „Polizist“ Dietmar Tuldi vergeblich, den völlig aufgelösten Hermann Simon zurückzuhalten. Tuldi ist im richtigen Leben beim Arbeitsamt angestellt und nebenberuflich Bürgermeister von Ellern. Einer von vielen Heimat-begeisterten Hunsrückern, die sich um eine Rolle beworben haben. Aus Respekt vor dem Werk – und dem Filmemacher Edgar Reitz, dem Hunsrücker. So freundlich Edgar Reitz am Morgen jeden Einzelnen begrüßt, danach konzentriert er sich ausschließlich auf seine Arbeit. Kaum mal ein Lächeln, keine privaten Gespräche. Andererseits strahlt der 70-jährige Regisseur viel Ruhe aus bei all der Hektik. Erklärt in knappen Worten, was er anders haben möchte, warum er wiederholen will, was besser sein muss. Jede neue Einstellung wird geprobt und wieder und wieder. Und dann erst folgt der Dreh und der zweite und dritte. Edgar Reitz ist Perfektionist. Das ist seine Stärke, und das unterscheidet seine Filme von vielen Filmchen.
Spannende „Heimat“-Szene an der Loreley- Hermann Simon (Henry Arnold) rennt zur Absturzstelle, begleitet vom Polizisten Dietmar Tuldi, im wahren Leben Bürgermeister von Ellern.
Um die Mittagszeit legt der Regisseur seine Weste ab und setzt die Sonnenbrille auf. Die Sonne sticht. Auf dem Rhein herrscht mittlerweile Hochbetrieb. Die Schiffe der weißen Flotte sind gut besetzt, die Passagiere schauen gebannt zum Ufer herüber, hier und da schallt aus einem Lautsprecher das Loreleylied „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten . . .“ Das fragen sich die Touristen beim Anblick des Spektakels auch. Erst auf den zweiten Blick ist das Geschehen zwischen Blaulicht und Qualm als eine „gespielte“ Katastrophe zu erkennen. Die „Goethe“ bleibt gar stumm. Für die Filmemacher ist das bei der Arbeit sogar von Vorteil, denn manchmal kann bereits das Tuckern der Schiffe störend sein. Vom Bahnlärm ganz zu schweigen! Selbst bei präziser Vorarbeit kann das nicht geplant werden. Aufnahmeleiter Herbert Ruf ist am Morgen einer der ersten am Drehort gewesen. Dann wird er den ganzen Tag über nicht mehr gesehen. Nicht an der Loreley, statt dessen aber ein paar hundert Meter weiter. Dort soll am nächsten Tag der Freitod von Matco gedreht werden. Wieder so eine knifflige Sache.
Kritisch & künstlerisch
Mit seinem „Heimat“-Zyklus hat Edgar Reitz (70) ein Stück Film- und Fernsehgeschichte geschrieben. Er verfilmte Ereignisse der Zeitgeschichte in seiner Heimat Hunsrück: in der ersten Folge (1984) das ländliche Leben in Schabbach nach dem Krieg, in der zweiten (1999) die Studentenzeit in den 60er-Jahren. Aus dem Hermännchen war Hermann geworden, vom Hunsrück hatte es ihn nach München gezogen. Insgesamt 42 Stunden Spieldauer – realistisch, kritisch, künstlerisch.
Die „Heimat 3“ ist eine „Chronik der Zeitenwende“. Der „Geschichtenerzähler“ Edgar Reitz blickt diesmal also auf die jüngste Vergangenheit zurück. Aufbruchstimmung nach dem Fall der Mauer. Veränderungen auch im Hunsrück, wo amerikanische Soldaten nach Hause gegangen sind und russische Familien kamen, um in der Fremde eine neue Heimat zu finden. In der Hoffnung auf ihre alte neue Liebe kehren auch Hermann Simon und Clarissa Lichtblau zurück.
Die Dreharbeiten für „Heimat 3“ werden im Oktober beendet sein. Sendetermin ist voraussichtlich Weihnachten 2004.
Artikel in der Rheinzeitung vom 08.09.2003
Hinweis: Alle Rechte (auch Vervielfältigung und Verbreitung) an den Texten und Bildern liegen bei der Rheinzeitung . (www.Rheinzeitung.de) Es liegt die schriftliche Genehmigung des Verlages vor.
